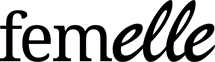All bodies are good bodies Bodyshaming und seine hässlichen Folgen
Wird jemand aufgrund seines Äusseren beleidigt oder diskriminiert, spricht man von Bodyshaming. Für die Opfer kann dies gravierende Folgen haben. Bodyshaming kann sich auf unterschiedliche Weise äussern. Wir klären dich über die gängigsten Formen von Bodyshaming auf und erläutern, welche Rolle Social Media spielt.

Was haben die Volleyball-Schiedsrichterin Martina Scavelli und die Sängerinnen Sarah Engels und Selena Gomez gemeinsam? Die drei Frauen mussten sich letzthin üble Kommentare über ihren Körper anhören. Vor allem auf Social Media findet Bodyshaming statt, ist aber auch sonst in der Gesellschaft verankert. Die Kommentare unter den Insta-Posts sind schonungslos: «zu kleine Brüste», «zu dick», «dein Po ist zu gross». Immer mehr Stars wehren sich öffentlich gegen Bodyshaming und stellen die beleidigenden Nachrichten online.
Bodyshaming: Das Wichtigste in Kürze
- Bodyshaming ist eine Form der Diskriminierung einer Person aufgrund ihres Äusseren. Wie sich Bodyshaming äussert
- Fat Shaming, Lookism, Ageism sind weitere Formen von Bodyshaming. Die häufigsten Arten von Bodyshaming
- Vor allem auf Social Media werden beleidigende Kommentare gegen das Aussehen von Menschen geschrieben. Die Gründe für Bodyshaming
- Bodyshaming belastet die Psyche der Betroffenen stark. Das sind die Folgen von Bodyshaming
- Gegen Bodyshaming kannst du dich wehren – sowohl für dich als auch für andere. Was du tun kannst
- Wie kannst du gesetzlich gegen Bodyshaming vorgehen?
Definition: Was Bodyshaming ist und in welchen Formen es sich äussert
Mit Bodyshaming ist jegliche Diskriminierung wegen des äusseren Erscheinungsbildes gemeint. Dabei werden Menschen wegen ihrer körperlichen Eigenschaften beleidigt oder beschämt. Dadurch finden Betroffene keinen Platz in der Gesellschaft und werden verdrängt. Graue Haare, eine sichtbare Behinderung oder Hochgewicht – alles, was nicht den gängigen Schönheitsidealen entspricht, wird beim Bodyshaming abwertend kommentiert.
Der Begriff Bodyshaming ist seit Mitte der 2010er Jahre weit verbreitet. Er setzt sich aus den englischen Wörtern «body» für Körper und «shaming» für Beschämen zusammen. Bodyshaming hat viele Facetten: Von einem vermeintlich gut gemeinten Ratschlag wie «du solltest gesünder essen» bis zu Hasskommentaren im Internet. Hier ist eine Auswahl der häufigsten Arten dieser Diskriminierung.
Zu dick, zu alt, zu hässlich: Beispiele für Bodyshaming
Fat Shaming
Die bekannteste Form von Bodyshaming ist das Fat Shaming. Diese zeigt sich in Beleidigungen und Blossstellungen wegen Hochgewicht sowie Stigmatisierungen im Alltag. Schmale Fitnessgeräte, die nicht genutzt werden können oder Flugzeugsitze, die nur für dünne Menschen designt wurden: obwohl unsere Gesellschaft immer dicker wird, finden Menschen mit Hochgewicht keine angemessende Repräsentation im Trend der Selbstoptimierung.
Ageismus
Wenn Menschen aufgrund von Stereotypen und Vorurteilen ihres Alters benachteiligt werden, spricht man von Altersdiskriminierung. Davon kann jede Altersgruppe betroffen sein. Ältere Menschen werden oft als gebrechlich und konservativ angesehen, während die jungen als naiv gelten. Dies ist vor allem im Arbeitsmarkt sichtbar, wo für die unterschiedlichen Altersgruppen verschiedene Bedingungen geschaffen werden.
Lookismus
Bei dieser Form von Bodyshaming wird das Aussehen mit dem Wert eines Menschen gleichgesetzt. Dies ist vor allem in der Arbeitswelt deutlich geworden: Studien haben belegt, dass grosse Männer mehr verdienen als kleinere. Beim Lookismus, auch Lookism bezeichnet, werden Menschen in Stereotypen von Schönheits- und Attraktivitätsnormen eingeteilt. Und wer ihnen nicht entspricht, ist weniger wert, faul oder hat es verdient, schlecht behandelt zu werden. Wer hingegen bevorzugt wird, weil sie oder er als schön angesehen wird, profitiert vom sogenannten Pretty Privilege.
Ableismus
Wird eine Person auf ihre körperliche oder geistige Behinderung reduziert, sprechen wir von Ableismus. Der Begriff stammt aus dem englischen «ableism» und setzt sich aus «to be able», zu Deutsch «fähig sein» zusammen. Die gesellschaftliche Normvorstellung schreibt dabei vor, wann ein Mensch fähig ist, etwas zu leisten. Die Diskriminierung behinderter Menschen führt dazu, dass sie im Alltag weniger sichtbar sind und weniger berücksichtigt werden, etwa bei der Barrierefreiheit öffentlicher Gebäude.
Weitere Formen
- Diskriminierung aufgrund der Körpergrösse: Heightism
- Diskiminierung aufgrund von Untergewicht: Skinny Shaming
- Diskriminierung aufgrund der Kleidung: Fashion Policing
- Diskiminierung aufgrund der Hautfarbe: Rassismus
- Diskriminierung aufgrund der äusserlichen Stereotypen des Geschlechtes: Sexismus

Die Gründe für Bodyshaming
Das Phänomen des Bodyshaming existiert schon seit Langem. Die Darstellung von Stereotypen in Filmen und auf Social Media verstärkt die bestehenden Idealvorstellungen. Die stark retuschierten Körper, die uns in der Werbung und sonst im Alltag gezeigt werden, zeigen uns das gerade aktuelle Schönheitsideal. Je öfters wir diese Körper sehen, desto normaler erscheinen sie uns. Dieser Mere-Exposure-Effekt beeinflusst unser Denken und unsere eigene Körperwahrnehmung.
Gerade auf Social Media häufen sich alle Formen von Bodyshaming. Menschen mit Behinderung werden als Meme-Grundlage genutzt oder prominente Personen wegen ihrer grauen Haare gedisst. Schnell in die Tasten getippt und den Frust rausgelassen – diskriminierende Kommentare finden sich en masse unter den Bildern. Dabei geht vergessen, dass hinter dem Online-Profil ein Mensch steht.
Welche Folgen Bodyshaming auf die betroffene Person hat
Die von Bodyshaming betroffenen Personen werden durch die Diskriminierungserfahrung psychisch stark belastet. Die Folgen sind Essstörungen wie Magersucht, ein geringes Selbstwertgefühl, Angstzustände und depressive Verstimmungen. Häufig ziehen sich die Betroffenen aus dem sozialen Umfeld zurück und isolieren sich.
Das kannst du gegen Bodyshaming machen
Wenn du Bodyshaming erfährst oder mitbekommst, kannst du dich dagegen wehren.
- Wenn dich jemand bodyshamed, lasse dir nicht alles gefallen und setzte deine Grenzen. Suche dir Gleichgesinnte und entferne Bodyshamer aus deinem Umfeld – auch aus Social Media.
- Wenn du mitbekommst, dass jemand diskriminiert wird, kannst du die Person fragen, wieso sie das tut, und setzte dich aktiv für die betroffene Person ein.
- Wenn du jemandem einen gut gemeinten Tipp geben möchtest, frage die Person zuerst, ob sie überhaupt deinen Ratschlag möchte und höre ihr vor allem zu. Und vergiss nicht: Es gibt keine Zusammenhänge zwischen den Charaktereigenschaften einer Person, ihrer Intelligenz oder anderen persönlichen Merkmalen und ihrem Körper. Wenn du dich bei einem missachtenden Gedanken ertappst, hinterfrage deine Vorurteile.
Wenn du von Bodyshaming betroffen bist und Hilfe suchst, ist Body Respect Schweiz eine gute Anlaufstelle.
Ist Bodyshaming strafbar?
Offen seine Meinung zu sagen, zu diskutieren, auch mal hitzig, all das muss in einer demokratischen Gesellschaft selbstverständlich erlaubt sein. Oder? Doch das Recht auf Meinungsfreiheit hört da auf, wo andere verletzt, fertig gemacht oder diskriminiert werden! Bodyshaming wird als Teil von Cybermobbing beschrieben: Cybermobbing gilt in der Schweiz zwar nicht als Straftat und kann auch nicht geahndet werden. Allerdings gibt es zahlreiche Bestimmungen des Strafgesetzbuchs, die es durchaus ermöglichen, Täter und Täterinnen zur Rechenschaft zu ziehen. So kann gegen Beschimpfungen und Persönlichkeitsverletzungen gesetzlich vorgegangen werden.
Jeder Körper ist schön: Die Bewegung Body Positivity setzt ein Zeichen
Auf Social Media sind in den letzten Jahren mehrere Bewegungen entstanden, die sich gegen Bodyshaming und unrealistische Schönheitsstandards wehren. Die bekannteste davon ist Body Positivity. Die Narbe auf der Wange, das Körpergewicht oder die Cellulite: die Bewegung sorgt für mehr Selbstliebe, mehr positive Körperwahrnehmung, weniger Kritik am eigenen Körper und an anderen. Die verwandte Bewegung Body Neutrality hingegen fokussiert sich auf die Funktionen des Körpers.
Film-Tipp
Die Dokumentation «Nie genug - Der Körperkult in sozialen Medien» von Jennifer Reznys geht der Frage nach, wieso es Bodyshaming gibt und wieso das Leid weitergeht.